Das Artensterben, der Klimawandel und der Verlust natürlicher Lebensräume zählen zu den drängendsten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig wächst weltweit der Wunsch vieler Menschen, beim Reisen ein Stück authentische Natur zu erleben.
Der Tourismus gilt allerdings als einer der Hauptauslöser für die destruktiven Eingriffe in die Natur. Eine aktuelle Studie hat daher untersucht, ob – und wenn ja wie – es gelingen kann, Reisen und Artenschutz miteinander in Einklang zu bringen.
Ist Reisen und Naturschutz ein Widerspruch?
Das Reisen zählt für viele Menschen zu den prägendsten Erfahrungen ihres Lebens. Als Ausgleich zu Job und Alltag wollen sie neue Orte entdecken, unbekannte Tier- und Pflanzenwelten erleben und eine andersartige Natur hautnah spüren.
Daher gewinnen naturnahe Reiseformate, bei denen die Reisenden möglichst wenig in die natürlichen Lebensräume eingreifen, immer mehr an Bedeutung. Auf der anderen Seite steht der Tourismus seit Jahren in der Kritik, wertvolle Ökosysteme zu belasten, die Wildtiere zu stören und den Ressourcenverbrauch massiv voranzutreiben.
In diesem Spannungsfeld hat sich eine sehr umfangreiche Metastudie von Natürlich Reisen mit der Frage befasst, ob Tourismus zum Schutz von Arten und Lebensräumen beitragen kann oder ob er am Ende genau jene Probleme verschärft, die er eigentlich lösen möchte?
Kann Tourismus ein Hoffnungsträger für den Natur- und Artenschutz sein?
Der Natur- und Ökotourismus galt viele Jahre als vielversprechender Hebel, um die Artenvielfalt zu bewahren und Schutzgebiete finanziell zu unterstützen. Internationale Organisationen wie die IUCN und zahlreiche Fachpublikationen weisen seit Jahren darauf hin, dass ein natürlicher Tourismus helfen kann, Naturschutzprojekte zu finanzieren, lokal Einkommen zu schaffen und das Bewusstsein für die Biodiversität zu stärken.
Tatsächlich zeigen Daten aus mehreren Regionen, dass die Einnahmen aus dem Tourismus einen bedeutenden Beitrag leisten können. In Costa Rica beispielsweise stammen rund 30 Prozent des Naturschutzhaushalts aus touristischen Geldern. Bei den südafrikanischen Nationalparks (SANParks) fließen sogar mehr als die Hälfte der Gesamterlöse aus touristischen Angeboten ein.
Diese Erkenntnisse lassen auf den ersten Blick den Rückschluss zu, dass Reisen ein wirksames Mittel ist, um bedrohte Arten zu schützen. Doch gerade der jüngere Forschungsstand macht deutlich, dass sich der positive Effekt nicht automatisch einstellt. Die Daten zeigen vielmehr: Tourismus kann sowohl Schutzmotor als auch Belastungsfaktor sein – abhängig davon, wie er gestaltet und gesteuert wird.
Wo trägt Tourismus tatsächlich zum Artenschutz bei?
Die Auswertung der Forschung zeigt, dass der Tourismus dann einen nachweislich positiven Beitrag zum Schutz von Arten und Lebensräumen leisten kann, wenn er klaren Nachhaltigkeitsprinzipien folgt und lokal verankert ist.
Ausschlaggebend ist nicht das Reiseangebot an sich, sondern die Art und Weise, wie es umgesetzt wird. Insbesondere der Community-based Tourism entfaltet hier eine doppelte Wirkung. Diese Art des Tourismus wird von der lokalen Bevölkerung initiiert und mitgestaltet.
Die Gemeinden entscheiden selbst über die Angebote, die Regeln und die Einnahmen. Dadurch steigt nicht nur die lokale Wertschöpfung, sondern meist auch die Bereitschaft, Natur- und Artenschutzmaßnahmen aktiv zu unterstützen.
Als besonders wirksam gelten laut der aktuellen Forschung folgende Erfolgsfaktoren:
- Lokale Partizipation und Mitbestimmung: Die Gemeinden müssen an der Planung, an den Entscheidungen und den Einnahmen beteiligt sein, damit der Naturschutz als gemeinsames Ziel getragen wird.
- Klare Regeln: Durch verbindliche Regeln zu den Belastungsgrenzen, den Schutzabständen und den Verhaltensstandards sollen Störungen von Tieren und Ökosystemen möglichst geringgehalten werden.
- Verbindliche Nachhaltigkeitsstandards: Zertifizierungen oder Siegel wirken nur dann, wenn sie transparent kontrolliert und nicht als Marketinginstrument zum Greenwashing eingesetzt werden.
Der wissenschaftliche Konsens: Ein nachhaltiger Tourismus kann dann wirken, wenn es klare Regeln und echte Teilhabe gibt.
Die Kehrseite: Wenn Tourismus Natur und Tiere belastet
So groß die Potenziale des Tourismus für den Artenschutz sind, so klar zeigen sich auch seine Schattenseiten. Besonders dort, wo die Besucherströme nicht reguliert werden oder Naturerlebnisse vermarktet werden, entstehen erhebliche Belastungen für die Ökosysteme und die Wildtiere. Auch der Naturtourismus kann das Verhalten von Tieren deutlich beeinflussen.
Ein Beispiel:
Eine Untersuchung der US-amerikanischen Ozeanbehörde NOAA zeigt, dass Angebote zur Walbeobachtung bei Buckelwalen messbare Stressreaktionen auslösen. Die Tiere erhöhten ihre Schwimmgeschwindigkeit um über sechs Prozent, verkürzten ihre Atemintervalle und wichen häufiger von ihren Routen ab.
Auch beim Gorillatrekking in Zentralafrika zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier soll ein Mindestabstand von sieben Metern das Risiko von Stress und Krankheitsübertragungen verringern. In der Praxis wird diese Regel jedoch in über 98 Prozent der Fälle unterschritten. Viele weitere Störfaktoren wie der hohe Ressourcenverbrauch, das erhöhte Abfallaufkommen und neue Verkehrswege wirken sich negativ auf sensible Lebensräume aus.
Ohne klare Regeln kann auch ein natürlicher Tourismus die Bemühungen um den Naturschutz unterlaufen.
Was macht also den Tourismus zu einem wirksamen Instrument für den Naturschutz?
Werden die drei wichtigen Rahmenbedingungen – lokale Teilhabe, klare Regeln und die Vergabe von kontrollierten Nachhaltigkeitssiegeln eingehalten, dann kann der Tourismus tatsächlich zum Schutz der Arten und der Umwelt beitragen.
Dabei zeigt die Meta-Studie aber auch die Erkenntnis auf, dass es strukturelle Grenzen gibt. Je mehr Schutzgebiete von touristischen Einnahmen abhängig sind, desto schneller geraten sie in Krisenzeiten unter Druck.
Die Gesamtbilanz fällt differenziert aus: Die Wirkung von nachhaltigem Tourismus hängt weniger vom Label ab, sondern von einem konsequenten Management.
Was bedeutet das für die Zukunft des Reisens?
Tourismus kann zum Schutz gefährdeter Arten beitragen, ist jedoch kein Selbstläufer. Entscheidend wird künftig sein, ob die Reiseangebote konsequenter an ökologischen Zielen ausgerichtet und lokale Gemeinschaften stärker einbezogen werden. Offene Fragen bleiben – etwa, wie Schutzgebiete langfristig finanziert werden können, ohne in eine einseitige Abhängigkeit vom Tourismus zu geraten und wie sich wirksame Standards weltweit durchsetzen lassen.
Wenn Reisen einen Beitrag zum Artenschutz leisten soll, braucht es verlässliche Regeln, transparente Strukturen und einen respektvollen Umgang mit der Natur und der Tierwelt. Die Zukunft des nachhaltigen Tourismus wird sich daran perspektivisch messen lassen.
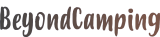
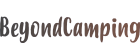














Kommentar schreiben